Was früher ein ungewöhnlicher Anblick im Wald war, ist heute absoluter Alltag in der Forstwirtschaft: die Baumfällung mit einem Harvester. Diese so genannte Vollerntemaschine fällt den Baum, schneidet die Äste vom Stamm und teilt diesen in seine qualitativ unterschiedlichen Abschnitte, und das vollständig maschinell. Er ist schnell, effizient und kostengünstig, bringt aber Nachteile mit sich und stößt auch an seine Grenzen. Wie ein Harvester ausschaut und wie man mit ihm arbeitet, erfährst Du in diesem Artikel.

Aufbau des Harvesters
Harvester können ganz unterschiedlich aussehen. Manche haben vier, andere acht Räder. Manch einer fährt sogar auf Ketten, wie bei einem Bagger, oder bewegt sich auf futuristischen Beinen fort (das nennt man einen Schreitharvester, hier könnt ihr euch anschauen, wie sowas aussieht). Ein Harvester wiegt rund 15 bis 24 Tonnen. Mit ihrem Kran können sie 7 bis 15 Meter weit greifen. Den Baum, den diese Vollerntemaschine greift, fällt sie dann mit Hilfe des sog. Harvesteraggregats.
An diesem Aggregat befinden sich das Sägeschwert, mit dem der Baum abgeschnitten wird, die Vorschubwalzen, die den Stamm im Aggregat vor und zurück bewegen und die Entastungsmesser, die die übrigen Äste am Stamm entfernen. Dazu gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Bestandteile, aber Ihr müsst ja im Anschluss keine Klausur über den Harvester schreiben können.
Die Kabine, in der der/die Harvesterfahrer*in sitzt, ist besonders stabil. Verstärkte Stahlrahmen und Panzerglas schützen den/die Fahrer*in vor herabstürzenden Ästen und anderem umherfliegenden Material.
Vorteile: schnell, günstig, sicher
Wie Ihr in unserem Video sehen konntet, arbeitet der Harvester sehr schnell und kann viele Bäume in kurzer Zeit fällen. Die Bäume sind nach dem Einsatz entastet und die qualitativ unterschiedlichen Teile des Stamms bereits mit der Säge voneinander getrennt. Gegenüber der Arbeitskosten der Forstwirt*innen ist das Fällen mit einer Vollerntemaschine deutlich günstiger. Außerdem wird die Berechnung der Masse und des Volumens der Stämme bereits automatisch durch den Computer im Harvester erledigt. Der/die Förster*in spart sich also viel Arbeit, wenn er/sie die Bäume später nicht mehr abmessen muss, um sie zu verkaufen.
Das in dem Video gezeigte Stück Wald besteht hauptsächlich aus Kiefern. Diese sind erkrankt und teilweise schon tot. Zu dieser Krankheit, dem Diplodia-Triebsterben, werdet Ihr hier bald lesen können. Tote und kranke Bäume bergen mit herabstürzenden abgestorbenen Ästen eine Gefahr für Leib und Leben. Von diesen gibt es in Zeiten des Waldsterbens 2.0 in Deutschland unzählige. Bei der Fällung erschüttert der Baum durch Sägen, Fällkeilen und Co. So sind die Forstwirt*innen der Gefahr herabfallenden Holzes nahezu schutzlos ausgesetzt. Der Einsatz eines Harvesters kann in solchen Wäldern Leben retten und das Holz trotzdem genutzt werden.
Nachteil: Bodenschäden
Häufig wird die Nutzung großer Maschinen in der Forstwirtschaft kritisiert. Die tonnenschwere Last soll die Böden langfristig zerstören. Und tatsächlich, die schweren Maschinen verdichten den Boden, über den sie fahren. Die unterirdischen Wasserbahnen im Boden werden dadurch zusammengedrückt und Wurzeln zerstört. Ein Boden der so zusammengedrückt wurde, erholt sich, wenn er es überhaupt tut, erst nach Jahrzehnten. Und in manchen Fällen niemals. Damit solche Schäden nicht entstehen, bzw. abgemildert werden, werden in der Forstwirtschaft viele Vorkehrungen getroffen. Am besten werden Böden nur dann befahren, wenn sie trocken oder gefroren sind. Das verringert die Auswirkungen des tonnenschweren Gewichts. Die Reifen sind besonders breit und verteilen so das Gewicht auf einer größeren Fläche. Außerdem ist der Harvester gezwungen, sich ausschließlich auf Rückegassen zu bewegen. Diese werden von dem/der Förster*in dauerhaft festgelegt und markiert. So beschränkt sich der entstandene Schaden auf einen kleineren Bereich. Ganz ausschließen lassen sich diese Nachteile aber leider nicht.
Schon gewusst? Rückegassen sind ein Verkehrssystem für den Wald
Wenn Bäume gefällt wurden, müssen sie ja auch irgendwie aus dem Wald transportiert werden. Das passiert meist mit großen Maschinen. Damit die nicht kreuz und quer durch den Wald fahren und dadurch junge Pflanzen zerstören oder den Boden verdichten, legt der Förster ein eigenes Straßensystem an. In der Regel gibt es alle 30 Meter eine so genannte Rückegasse. Nur auf diesen Wegen dürfen dann die schweren Maschinen fahren, die das Holz aus dem Wald bringen. Achtet doch mal bei Eurem nächsten Waldbesuch darauf, ob ihr Rückegassen findet, und wie weit diese auseinander liegen!
Grenzen: Steilhang und Nässe
Wenn der Harvester so effizient und schnell ist, dann müssten die Motorsägen der Forstwirt*innen in Deutschland für immer still stehen, oder? Nein, auch der Harvester kann nicht alles und stößt an seine Grenzen. An Steilhängen droht er schnell zu kippen und in sehr feuchten Wäldern zu versinken. Außerdem kann das oben erklärte Harvesteraggregat nur Bäume bis zu einem gewissen Durchmesser greifen und schneiden. Besonders dicke Bäume müssen dann die Forstwirt*innen mit ihren Motorsägen fällen. Bei sehr dünnen Bäumen ist der Harvester sogar langsamer und teurer als der Mensch.
Ein weiteres Kriterium schränkt den Harvester ein:
Ein Zeugnis für Wälder?
Auch Wälder und deren Bewirtschaftung können zertifiziert sein, ähnlich wie Bio-Siegel bei Lebensmitteln. Die bekanntesten Zertifizierungsrichtlinien für Deutsche Forsten sind die des FSC und des PEFC. Sie unterscheiden sich nur in wenigen Punkten. Vereinfacht kann man aber sagen, dass der FSC etwas strenger ist. Das ist aber nochmal ein Thema für einen eigenen Artikel. In Wäldern, die vom FSC zertifiziert sind, müssen die Rückegassen möglichst 40 Meter auseinander liegen. Soweit kann der Harvester natürlich nicht greifen. Hier müssen also auch wieder unsere Forstwirt*innen helfen.
Ganz wichtig: Abstand halten!
Habt ihr schonmal einen Harvester im Wald gesehen? Wir finden es ziemlich beeindruckend, den riesigen Maschinen bei ihrer effizienten Arbeit zuzuschauen. Aber: Achtung! Wenn Ihr einmal einen Harvester bei der Arbeit seht, heißt es Abstand halten. Nicht 1,5 Meter sondern satte 50 bis 70 Meter! Immer wieder passieren tödliche Unfälle, weil sich nähernde Personen vom Fahrer*in nicht erkannt werden.











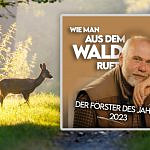






Fred Hageb
22. Juni 2021 — 17:14
Ohne Havester geht es nicht.
Die sich künstlich aufregen sind Ignoranten ind beratungsresistent.
Fred Hagen.
Felix
26. Juni 2021 — 12:10
Ganz pauschal kann man das so natürlich nicht sagen. Es geht ohne, hat man früher ja auch geschafft. Es ist nur einfach unwirtschaftlich.
Natürlich muss man die Schäden auch minimieren. Tiefe Fahrspuren sehen nicht nur hässlich aus, sie zerstören den Boden auch nachhaltig.
Grüße
Felix
Wilhelm Prof. Denninger
16. Dezember 2021 — 11:13
Wilhelm Denninger, 16.12.2021
der Aussage von Fred Hageb, dass es heute nicht mehr ohne Harvester geht, wird vollumfänglich geteilt. Dies zeigt sich besonders bei der aktuellen Kalamitätsbewältigung und nicht nur dort! Der Autor sollte seinen fehlerbehafteten Beitrag anhand des aktuell verfügbaren Wissenstandes nochmals inhaltlich überarbeiten!
MfG
W. Denninger
Wilhelm Prof. Denninger
16. Dezember 2021 — 12:43
dem Kommentar von Fred Hageb, dass es ohne Harvester nicht mehr geht, wird vollumfänglich geteilt! Dies zeigt sich besonders bei der aktuell zu bewältigenden Kalamität der letzten Jahre, sondern nicht nur dort. Die Antwort des Autors, dass man dies auch früher geschafft hat (also mit motormanueller/ggfls. teilmechanisierter Holzernte), verkennt die aktuelle betriebliche Situation und Lage der Forstbetriebe.
Auf Grund inhaltlicher Schwächen des Beitrages würde ich eine nochmalige Überarbeitung des Beitrages anhand des aktuell verfüg- und erschließbaren Wissensstandes empfehlen!
MfG
W. Denninger
Felix
31. Januar 2022 — 09:17
Moin Wilhelm,
vielen Dank für Deinen freundlichen Kommentar. Inwiefern weißt der Artikel inhaltliche Schwächen auf? Kannst Du diese genau benennen?
Ich stehe auch weiterhin hinter meiner Aussage, mit dem Zusatz, dass es unwirtschaftlich ist.
Beste Grüße nach Holzerode
Felix
Felix
31. Januar 2022 — 09:17
Moin Wilhelm,
vielen Dank für Deinen freundlichen Kommentar. Inwiefern weißt der Artikel inhaltliche Schwächen auf? Kannst Du diese genau benennen?
Ich stehe auch weiterhin hinter meiner Aussage, mit dem Zusatz, dass es unwirtschaftlich ist.
Beste Grüße nach Holzerode
Felix
Altaa
10. September 2022 — 17:09
Selten so einen beschissen geschriebenen Kommentar/*in gelesen. Diese Gender-Kacke macht ihn unkenntlich bis zur Unleserlichkeit – zumal ihr sexistisch gendert, oder seit wann ist Boden männlich? Es heißt schließlich Mutter Erde, also auch die Bodenin.
Felix
20. September 2022 — 13:00
Danke für Deinen geistreichen Kommentar. Wir werden Deinen begründeten Einwand in Zukunft sicher berücksichtigen.
Beste Grüße
Felix
Paul Trabb
16. Februar 2024 — 15:17
Ich finde die Forsttechnik sehr faszinierend. Früher habe ich noch viele Bäume per Hand gefällt. Dass das jetzt mit nur einem Knopfdruck so schnell geht, ist echt atemberaubend.